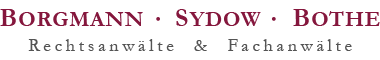Unsere Experten in Schöneberg-Tempelhof:
Rechtsanwältin Anja Bothe und Rechtsanwältin Catrin Gastberg
 |
 |
Kaum etwas wenig kann so schwierig sein, wie Streitigkeiten in der Familie. Diese gehen sehr schnell an die Substanz und die Beteiligten finden in psychisch und finanziell stark belastenden Auseinandersetzungen.
Das Familienrecht ist sehr stark durch die – teilweise regional verschiedene – Rechtsprechung und die unterschiedlichen Lebensumstände der Beteiligten geprägt.
Fundierte und hoch qualifizierte familienrechtliche Beratung ist unerlässlich, um ihre Interessen zu wahren und die Auseinandersetzung so schnell und so gut wie unter den Umständen möglich abzuschließen.
Mit Fachanwältin für Familienrecht Anja Bothe und Fachanwältin für Familienrecht Catrin Gastberg stehen Ihnen bei uns dafür erfahrene, sachkundige und kompetente Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
Wir beraten und vertreten Sie in allen Bereichen des Familienrechts. Anlass für Streitigkeiten sind im Familienrecht insbesondere:
Trennung / Scheidung
Streitigkeiten bei der Trennung und Scheidung von Beziehungen sind für die Beteiligten äußerst belastend und können ein Vermögen kosten. Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei allen damit zusammenhängenden Fragen für die Trennung und die nachfolgende Ehescheidung oder Auflösung der Lebenspartnerschaft. Dies betrifft insbesondere den richtigen Zeitpunkt für die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens oder die Reaktion auf ein bereits eingeleitetes Verfahren und alle damit zusammenhängenden Fragen. Für die Einleitung des gerichtlichen Scheidungsverfahrens besteht Anwaltszwang und zwar unabhängig davon, welche Form von Scheidung (einverständlich oder streitig) durchgeführt wird und wie lange die Trennungszeit betragen hat.
Unterhalt im Familienrecht
Unterhaltspflichten gibt es zwischen Ehegatten/Lebenspartnern und zwischen Eltern und Kindern (Kindesunterhalt/Elternunterhalt) sowie u.U. zwischen anderen Verwandten in gerader Linie (Großeltern/Enkel).
Die rechtlichen Voraussetzungen unterscheiden sich dabei erheblich. Allen Unterhaltsfragen gemeinsam ist aber, dass sämtliche damit zusammenhängenden Fragen vom jeweiligen Einzelfall abhängen und präzise Kenntnisse über die zuständige Rechtsprechung erfordern.
Dies gilt sowohl für die Frage, ob Unterhalt geschuldet wird als auch für die Frage, in welcher Höhe Unterhalt geschuldet wird. Dabei sind primär Themen wie Leistungsfähigkeit, Bedürftigkeit, Einkünfte, Erwerbstätigenbonus, Selbstbehalt, (fiktiver) Wert der Haushaltsführung und der Kindererziehung, Erwerbsobliegenheit, vermögenswerte Vorteile, Wohnvorteil, ehebedingte Nachteile, Wegfall, Befristung und Herabsetzung sowie Verwirkung wichtig.
Eine gründliche Prüfung und Beratung auf der Grundlage genauer Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften, unterhaltsrechtlichen Leitlinien und zuständigen Rechtsprechung ist danach für eine optimale Wahrnehmung Ihrer Interessen unerlässlich, auch um zu entscheiden, ob eine gerichtliche Auseinandersetzung erforderlich ist oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten in Betracht kommt.
Vermögensfragen / Zugewinnausgleich / Hausrat
Vermögensfragen haben im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung häufig eine erhebliche Bedeutung. Dies betrifft insbesondere die Frage, was gemeinsames Vermögen ist und was mit dem gemeinsamen Vermögen geschieht.
Ein häufig anzutreffendes Missverständnis ist, dass in der Ehe/Partnerschaft alles gemeinsames Eigentum der Ehegatten/Partner wird. Diese Frage hängt aber vom sog. Güterstand ab. Regelfall ist die sog. Zugewinngemeinschaft, wonach sich an den Eigentumsverhältnissen nichts ändert, aber beide Eheleute/Partner je zur Hälfte an dem Vermögenszuwachs während der Ehe/Partnerschaft teilhaben sollen.
Anderes gilt hingegen für den Hausrat, d.h. alle beweglichen Gegenstände, die während der Ehe/Partnerschaft angeschafft wurden und im gemeinsamen Haushalt genutzt werden bzw. wurden und der gemeinsamen Lebensführung dienen. Dabei wird gemeinsames Eigentum vermutet.
Weiterhin ist regelmäßig auch die Frage der zukünftigen Nutzung der Ehewohnung bzw. Partnerschaftswohnung zu klären, wobei auch eine gerichtliche Wohnungszuweisung beantragt werden kann.
Versorgungsausgleich
Bei der Ehescheidung ist regelmäßig über den Versorgungsausgleich zu entscheiden, d.h. über die interne Teilung von in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüchen und Versorgungsanrechten.
Die damit zusammenhängenden Fragen sind vielfältig und kompliziert, was mit der Vielzahl von Versorgungen, wie gesetzlicher Rentenversicherung und anderer Regelsicherungssysteme wie der berufsständischen Pflichtversorgung, der Beamtenversorgung und der betrieblichen sowie der privaten Altersversorgung zusammenhängt. Besondere Konstellationen können sich darüber hinaus z.B. bei privaten Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht ergeben.
Kindschaftrecht / Elterliches Sorgerecht / Umgangsrecht
Ein wesentliches Thema bei Trennung und Scheidung sind Fragen betreffend gemeinsamer/adoptierter minderjähriger Kinder. Die damit zusammenhängenden Fragen betreffen u.a. die Ausübung der elterlichen Sorge für die persönlichen und finanziellen Belange des Kindes, Unterhalt, das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie Häufigkeit und Dauer des Umgangsrechtes.
Auseinandersetzungen in diesem Bereich sind häufig sehr belastend für alle Beteiligten. Dabei sind die Interessen des Kindes vorrangig zu berücksichtigen. Unsere rechtliche Beratung und Vertretung erstreckt sich deshalb auch darauf, eine möglichst schnelle Klärung herbeizuführen, sei es durch ein gerichtliches Verfahren oder eine rechtlich verbindliche außergerichtliche Vereinbarung.
Darüber hinaus bieten wir auch Mediation an, d.h. die Klärung von Konflikten mit Hilfe eines Streitvermittlers. Hierfür steht Ihnen Rechtsanwalt und lizensierter Mediator BM® Olav Sydow als Ansprechpartner zur Verfügung.
Anwaltshonorar
Die Gebühren für die rechtsanwaltliche Tätigkeit ergeben sich aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und werden anhand des Gegenstandswerts bemessen, der sich aus dem Streitgegenstand ergibt oder wir treffen eine individuelle Vergütungsvereinbarung mit Ihnen.
Für Bürger mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe für die Verfolgung oder Verteidigung ihrer Rechte im familiengerichtlichen Verfahren bewilligt zu bekommen.
Vereinbaren Sie mit uns einen Besprechungstermin. Wir klären mit Ihnen gerne alle anstehenden Fragen ausführlich und in Ruhe.
FAQ: Häufige Fragen und Antworten zum Familienrecht:
Wie lassen sich komplexe Vermögensverhältnisse bei der Scheidung fair und rechtssicher aufteilen, insbesondere bei Selbstständigen oder Gesellschaftern?
Die Aufteilung von Vermögen bei einer Scheidung wird umso komplizierter, je vielschichtiger die wirtschaftlichen Verhältnisse und je komplexer die Vermögensverhältnisse sind. Dies gilt besonders bei Selbstständigen, Freiberuflern oder Gesellschaftern von Unternehmen. Entscheidend ist eine transparente Ermittlung und Bewertung des Vermögens, damit eine faire Grundlage für die Verhandlungen geschaffen wird.
Was bedeutet Zugewinngemeinschaft und warum ist sie wichtig?
In Deutschland leben Ehepaare ohne Ehevertrag automatisch im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet:
-
Bei der Scheidung erfolgt ein Zugewinnausgleich: Der Ehepartner mit dem höheren Vermögenszuwachs während der Ehe muss die Hälfte der Differenz an den anderen ausgleichen.
-
Auch Unternehmenswerte zählen: Beteiligungen und Firmenvermögen unterliegen grundsätzlich dem Zugewinnausgleich – unabhängig davon, ob beide Partner im Unternehmen mitgearbeitet haben.
Beispiel: Wenn ein Ehepartner während der Ehe eine GmbH aufgebaut hat, die nun 500.000 € wert ist, kann der andere Partner Anspruch auf einen Teil dieses Wertzuwachses haben – auch ohne aktive Mitarbeit im Unternehmen.
Wichtige Aspekte bei der Vermögensaufteilung
1. Vollständige Auflistung des Vermögens
Zunächst muss das gesamte Vermögen beider Ehegatten offengelegt werden:
-
Unternehmensbeteiligungen
-
Immobilien
-
Wertanlagen und Kapitalvermögen
-
Schulden und Verbindlichkeiten
2. Bewertung von Unternehmen und Beteiligungen
Die Bewertung von Geschäftsvermögen ist besonders anspruchsvoll:
-
Stichtag: Unternehmensanteile müssen zum Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrags bewertet werden – oft durch unabhängige Sachverständige.
-
Versteckte Werte: Auch nicht ausgeschüttete Gewinne, stille Reserven (versteckte Wertsteigerungen im Unternehmen) oder entnahmefähige Mittel spielen eine Rolle.
-
Unternehmensschutz: Eine Scheidung ohne vertragliche Regelung kann zu Liquiditätsproblemen führen oder das Unternehmen sogar gefährden.
3. Trennung von Privat- und Betriebsvermögen
Wichtig ist die Unterscheidung, ob es sich um rein betriebliches Vermögen handelt oder ob private Vermögenswerte mit dem Unternehmen verflochten sind. Diese Abgrenzung beeinflusst maßgeblich den Zugewinnausgleich.
4. Schutz des Unternehmens
Das Gesetz schützt Unternehmen davor, durch eine Scheidung in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Daher wird häufig eine Ausgleichszahlung anstelle einer direkten Aufteilung des Unternehmensvermögens vorgesehen – so bleibt der Betrieb handlungsfähig.
5. Vertragliche Regelungen schaffen Klarheit
Eheverträge oder Gesellschaftervereinbarungen können im Vorfeld festlegen, wie im Fall der Scheidung mit Unternehmensanteilen umgegangen wird. Solche Vereinbarungen schaffen frühzeitig Rechtssicherheit und verhindern Streitigkeiten.
Falls noch keine Regelungen bestehen, kann eine Scheidungsfolgenvereinbarung geschlossen werden mit:
-
Gütertrennung oder modifizierter Zugewinngemeinschaft (angepasste Regelungen zum Vermögensausgleich)
-
Ausschluss oder Begrenzung des Zugewinnausgleichs für Unternehmenswerte
-
Regelungen zur Unternehmensfortführung, Abfindungsmodalitäten und Versorgungsausgleich
Besonderheiten bei Gesellschaftsverträgen:
-
Gesellschaftsverträge sollten Scheidungsklauseln enthalten, um die Übertragung oder Bewertung von Anteilen zu regeln
-
Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG) kann die Scheidung eines Gesellschafters auch Folgen für die Haftung haben – etwa wenn der Ex-Partner plötzlich Mitgesellschafter werden würde
-
Eine frühzeitige Abstimmung mit den Mitgesellschaftern ist empfehlenswert
6. Individuelle und kreative Lösungen
Jede Vermögenssituation ist einzigartig. Oft sind flexible Ansätze notwendig, etwa durch:
-
Ratenzahlungen über mehrere Jahre
-
Übertragung anderer Vermögenswerte (z. B. Immobilien statt Unternehmensanteile)
-
Einräumung von Nutzungsrechten
Praktische Schritte zur fairen Vermögensaufteilung
-
Vollständige Vermögensaufstellung beider Ehepartner inkl. Unternehmenswerte, Immobilien, Kapitalanlagen
-
Transparente Bewertung durch externe Gutachter bei komplexen Vermögensstrukturen
-
Verhandlungslösungen zur Vermeidung langwieriger gerichtlicher Auseinandersetzungen
-
Steuerliche Beratung zur Optimierung der Vermögensübertragung und Vermeidung unnötiger Steuernachteile
Fazit
Eine faire und rechtssichere Aufteilung komplexer Vermögensverhältnisse erfordert Fachwissen, Erfahrung und oftmals die Zusammenarbeit mit externen Gutachtern. Es braucht eine individuelle Bewertung, durchdachte vertragliche Gestaltung und interdisziplinäre Beratung.
Unser Rat: Gerade Selbstständige und Unternehmer profitieren von frühzeitiger anwaltlicher Beratung – idealerweise schon vor einer möglichen Trennung. So lassen sich wirtschaftliche Nachteile, langwierige Streitigkeiten und existenzbedrohende Situationen vermeiden. Lassen Sie sich beraten, bevor Probleme entstehen – das spart Zeit, Geld und Nerven.
Welche Kriterien bestimmen die Höhe von Ehegatten- und Kindesunterhalt bei hohen Einkommen oder ungleich verdienenden Partnerschaften?
In Partnerschaften mit hohen oder sehr unterschiedlichen Einkommen richtet sich der Unterhalt nach dem konkreten Bedarf und dem Lebensstandard während der Ehe. Die Düsseldorfer Tabelle (eine bundesweit verwendete Richtlinie zur Unterhaltsberechnung) reicht hier oft nicht aus – eine individuelle rechtliche Bewertung ist notwendig.
Wichtige Grundsätze
-
Kinder und Ehegatten haben Anspruch auf Teilhabe am gehobenen Lebensstil (§ 1610 BGB, § 1361 BGB)
-
Die Berechnung erfolgt entweder nach festen Quoten oder – bei sehr hohem Einkommen – nach konkret nachgewiesenem Bedarf
-
Es gilt: Nicht jeder Euro wird automatisch berücksichtigt, sondern nur der „angemessene Bedarf“
Wie wird der Ehegattenunterhalt bei hohen Einkommen berechnet?
Der Ehegattenunterhalt orientiert sich am gemeinsamen Lebensstandard während der Ehe. Bei sehr hohen Einkommen wird jedoch geprüft, ob das Einkommen einen „angemessenen Bedarf“ übersteigt.
Entscheidende Faktoren:
-
Einkommenshöhe beider Partner: Wie groß ist der Unterschied im Verdienst?
-
Rollenverteilung während der Ehe: Hat ein Partner seine Karriere zugunsten der Familie zurückgestellt?
-
Ehedauer: Längere Ehen führen tendenziell zu höheren Unterhaltsansprüchen.
-
Luxuslimit: Ab einem bestimmten Einkommensniveau wird der Unterhalt auf ein angemessenes Maß begrenzt.
Beispiel: Verdient ein Ehepartner 20.000 € netto monatlich, wird nicht automatisch die Hälfte als Unterhalt fällig. Stattdessen wird geprüft, welcher Betrag dem bisherigen Lebensstandard entspricht und welcher Teil des Einkommens der Vermögensbildung diente.
Unser Tipp: Bei sehr hohen Einkommen empfiehlt sich oft eine individuelle Vereinbarung, um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Nach welchen Kriterien bemisst sich der Kindesunterhalt bei hohen Einkommen?
Für den Kindesunterhalt dient die Düsseldorfer Tabelle als Ausgangspunkt. Diese endet allerdings bei einem bereinigten Nettoeinkommen von 11.000 € monatlich. Liegt das Einkommen darüber, wird individuell berechnet.
-
Gesamteinkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils (nach Abzug bestimmter Kosten)
-
Bedarf des Kindes – orientiert am bisherigen Lebensstil, Schule, Hobbys und Aktivitäten
-
Luxusverbot: Kinder sollen am Wohlstand teilhaben, aber keine überzogenen Luxusbedürfnisse geltend machen können.
Beispiel: Ein Kind, das bisher Privatschule und Reitunterricht hatte, kann diese Kosten als Teil des gewohnten Lebensstandards geltend machen. Ein plötzlicher Wunsch nach Designerkleidung ohne bisherige Gewohnheit wäre jedoch nicht automatisch berücksichtigungsfähig.
Was gilt bei stark ungleich verdienenden Ehepartnern?
Wenn ein Partner deutlich mehr verdient, wird ein Ausgleich über Quoten vorgenommen. Der wirtschaftlich schwächere Partner hat Anspruch auf einen Teil des Gesamteinkommens, um den ehelichen Lebensstandard fortführen zu können.
Der Halbteilungsgrundsatz: Grundsätzlich kann der berechtigte Ehegatte bis zur Hälfte des für den Unterhalt verfügbaren Einkommens beanspruchen.
Die Sättigungsgrenze: Bei sehr hohem Einkommen greift eine Obergrenze: Es wird vermutet, dass ein Teil des Einkommens der Vermögensbildung (z. B. Sparen, Investitionen) diente und nicht dem laufenden Lebensbedarf. In diesem Fall muss der Unterhaltsberechtigte den konkreten Bedarf nachweisen.
Weitere Faktoren:
-
Eigene Einkünfte: Auch die Einkünfte des Berechtigten werden berücksichtigt.
-
Kinderbetreuung: Wer Kinder betreut, hat eingeschränkte Erwerbsmöglichkeiten.
-
Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit: Wird geprüft, ob dem wirtschaftlich schwächeren Partner eine eigene Berufstätigkeit zugemutet werden kann.
Was bedeutet „bereinigtes Nettoeinkommen“?
Das bereinigte Nettoeinkommen ist die Berechnungsgrundlage für den Unterhalt. Es entspricht nicht dem reinen Nettogehalt, sondern wird um bestimmte Posten reduziert:
-
Steuern und Sozialabgaben
-
Berufsbedingte Aufwendungen (z. B. Fahrtkosten, Arbeitskleidung)
-
Schulden unter engen Voraussetzungen
-
Angemessene Altersvorsorgeaufwendungen
Besonderheiten bei hohen Einkommen: Boni, Aktienoptionen, Tantiemen und steuerliche Gestaltungen müssen detailliert geprüft werden. Hier liegt häufig die größte Streitquelle, da nicht immer klar ist, welche Einkommensbestandteile berücksichtigt werden müssen.
Beispiel: Ein Manager erhält neben dem Grundgehalt von 8.000 € einen jährlichen Bonus von 60.000 €. Dieser Bonus wird auf 12 Monate umgerechnet und fließt in die Unterhaltsberechnung ein.
Wie lässt sich der Unterhalt in der Praxis durchsetzen oder begrenzen?
Unterhalt kann auf zwei Wegen geregelt werden:
-
Gerichtliche Entscheidung: Ein Gericht legt die Unterhaltshöhe fest.
-
Einvernehmliche Vereinbarung: Die Partner einigen sich außergerichtlich.
Empfehlung bei hohen Einkommen: Eine individuelle Vereinbarung ist oft sinnvoll, um Streit über das „Luxuslimit“ oder die genaue Höhe des Kindesbedarfs zu vermeiden. Voraussetzung ist eine vollständige und transparente Offenlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse.
Zusammenfassung: Die wichtigsten Punkte auf einen Blick
-
Bei Einkommen über 11.000 € monatlich reicht die Düsseldorfer Tabelle nicht aus.
-
Der Unterhalt orientiert sich am tatsächlichen Bedarf und bisherigen Lebensstandard.
-
Es gilt ein „Luxuslimit“ – nicht jeder Euro wird automatisch berücksichtigt.
-
Längere Ehen und klassische Rollenverteilung führen zu höheren Ansprüchen.
-
Vollständige Offenlegung der Finanzen ist entscheidend für faire Regelungen.
-
Individuelle Vereinbarungen sind oft besser als langwierige Gerichtsverfahren.
Sie haben Fragen zu Ihrem konkreten Fall? Jede Situation ist einzigartig. Die Berechnung von Unterhalt bei hohen Einkommen erfordert fundierte rechtliche Expertise und eine genaue Analyse Ihrer individuellen Verhältnisse. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Erstgespräch – wir beraten Sie kompetent zu Ihren Ansprüchen oder Verpflichtungen und entwickeln mit Ihnen eine passende Strategie.
Ein Ehevertrag – warum er so wichtig sein kann
Ein Ehevertrag ermöglicht es Ihnen, die finanziellen Folgen einer möglichen Scheidung individuell zu regeln. In bestimmten Lebenssituationen ist er nicht nur sinnvoll, sondern nahezu unverzichtbar, um spätere Konflikte und wirtschaftliche Risiken zu vermeiden.
1. Unternehmensbeteiligungen und Selbstständigkeit
Wann ist ein Ehevertrag hier wichtig? Wenn ein Ehepartner Unternehmer ist, eine Firma führt oder Anteile an einem Unternehmen hält, kann eine Scheidung ohne Ehevertrag existenzbedrohend werden.
Warum ist das problematisch? Ohne Ehevertrag gilt der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet: Ihr Partner hat im Scheidungsfall Anspruch auf die Hälfte der Wertsteigerung – auch von Firmenanteilen.
Die Folgen können dramatisch sein:
-
Um den Ausgleich zu zahlen, müssten Sie möglicherweise Unternehmensanteile verkaufen
-
Dies kann die Liquidität gefährden und den Fortbestand der Firma bedrohen
-
Die Bewertung von Unternehmensanteilen ist aufwendig und kostspielig – oft sind teure Sachverständigengutachten erforderlich
Die Lösung:Ein individuell gestalteter Ehevertrag (z. B. modifizierte Zugewinngemeinschaft oder Gütertrennung) schafft klare Regelungen und schützt die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens.
2. Internationale Ehen oder Auslandsbezug
Wann wird es kompliziert? Bei binationalen Ehen oder wenn ein Partner im Ausland lebt, arbeitet oder Vermögen besitzt, entsteht schnell rechtliche Unsicherheit.
Die zentrale Frage: Welches Recht gilt im Scheidungsfall – deutsches Recht oder das Recht des anderen Landes? Die Unterschiede können erheblich sein und zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Was regelt ein Ehevertrag? Ein Ehevertrag schafft Klarheit durch verbindliche Festlegungen:
-
Welches Recht angewendet wird (Rechtswahl)
-
Welches Gericht zuständig ist (Gerichtsstand)
-
Wie mit dem Vermögen umgegangen wird (Güterstand)
Dies verhindert kostspielige und langwierige Streitigkeiten über Zuständigkeit und anzuwendendes Recht.
3. Erhebliche Vermögensunterschiede
Wann ist Vorsorge sinnvoll? Wenn ein Partner bereits über erhebliches Vermögen verfügt – etwa durch Immobilien, Beteiligungen oder Erbschaften – sollte dieses gezielt abgesichert werden.
Das Problem ohne Ehevertrag: Im Scheidungsfall erfolgt eine pauschale hälftige Beteiligung am während der Ehe erwirtschafteten Vermögenszuwachs, unabhängig von dessen Herkunft oder Struktur.
Die maßgeschneiderte Lösung: Ein Ehevertrag ermöglicht eine individuelle Vermögensregelung, etwa durch den Ausschluss bestimmter Vermögenswerte vom Zugewinnausgleich.
4. Patchwork-Familien und Erbregelungen
Besondere Konstellation: Bei einer erneuten Eheschließung, insbesondere wenn Kinder aus früheren Beziehungen vorhanden sind, empfiehlt sich ein Ehevertrag zur klaren Regelung.
Was wird geregelt?
-
Schutz der Interessen von Kindern aus früheren Beziehungen
-
Gezielte erbrechtliche Gestaltung und Vorbehalt von Vermögen für bestimmte Erben
-
Klarheit bei Pflichtteilsansprüchen und Versorgungsfragen
-
Koordination mit Testament und Erbvertrag
Ein Ehevertrag dient hier nicht nur dem Schutz der Ehepartner, sondern auch der Absicherung der Kinder.
Wichtige rechtliche Rahmenbedingungen
Form: Ein Ehevertrag muss notariell beurkundet werden (§ 1410 BGB). Eine privatschriftliche Vereinbarung ist unwirksam.
Grenzen: Der Vertrag darf keinen Partner sittenwidrig benachteiligen (§ 138 BGB) und muss transparent und ausgewogen gestaltet sein.
Anpassung: Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung bei veränderten Lebensverhältnissen (z. B. Geburt von Kindern, berufliche Veränderungen) ist empfehlenswert.
Fazit
Ein Ehevertrag ist nicht nur ein Instrument zur Vermögenssicherung, sondern in bestimmten Konstellationen – etwa bei Unternehmensbeteiligungen oder internationalem Bezug – rechtlich geboten. Er minimiert Risiken und schafft klare Verhältnisse.
Unser Tipp: Eine frühzeitige, fachkundige Beratung ist unerlässlich. Wir analysieren Ihre persönliche Situation, beraten Sie umfassend und entwickeln mit Ihnen eine Regelung, die exakt zu Ihren Lebensumständen passt und notariell beurkundet werden kann. Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin.
Wie lässt sich das Sorge- und Umgangsrecht in konfliktbelasteten Trennungssituationen sachgerecht regeln?
Nach der Trennung – das Sorge- und Umgangsrecht
Nach einer Trennung stehen Eltern vor der Herausforderung, das Leben mit ihren Kindern neu zu organisieren. Dabei entstehen oft Konflikte über das Sorge-und Umgangsrecht wie Betreuungszeiten, Wohnort oder Erziehungsfragen.
Wichtig zu wissen: Beide Elternteile behalten grundsätzlich das gemeinsame Sorgerecht und das Recht auf regelmäßigen Kontakt zu ihren Kindern – und die Kinder haben umgekehrt ein Recht auf beide Eltern.
Was sagt das Gesetz zum Umgangsrecht?
-
Nach § 1684 BGB (dem gesetzlichen Umgangsrecht) hat jedes Kind das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen.
-
Auch die Eltern haben ein Recht auf Umgang mit ihrem Kind.
-
Dieses Recht besteht unabhängig vom Sorgerecht und bleibt auch nach der Trennung bestehen.
Welche Betreuungsmodelle gibt es?
-
Residenzmodell: Das Kind lebt überwiegend bei einem Elternteil, der andere erhält regelmäßige Umgangszeiten (z. B. jedes zweite Wochenende plus einen Nachmittag unter der Woche).
-
Wechselmodell (Doppelresidenz): Das Kind lebt abwechselnd bei beiden Elternteilen (z. B. im wöchentlichen Wechsel). Dies funktioniert nur bei räumlicher Nähe der Wohnorte und guter Kommunikation zwischen den Eltern.
-
Nestmodell: Das Kind bleibt in der gemeinsamen Wohnung, die Eltern wechseln sich dort ab. Dieses Modell wird selten praktiziert, ist aber rechtlich möglich.
Wie können Eltern Konflikte über das Sorge- und Umgangsrecht vermeiden?
-
Schriftliche Vereinbarungen schaffen Klarheit und Verlässlichkeit für alle Beteiligten – besonders für die Kinder.
-
Mediation oder Beratung durch das Jugendamt können helfen, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.
-
Einvernehmliche Regelungen sind dem Kindeswohl meist deutlich zuträglicher als gerichtliche Auseinandersetzungen und belasten die Kinder weniger.
Was passiert, wenn wir uns nicht einigen können?
-
Auf Antrag eines Elternteils entscheidet das Familiengericht – immer mit Blick darauf, was für das Kind am besten ist (§ 1697a BGB).
-
Das Gericht kann konkrete Umgangszeiten festlegen oder in Ausnahmefällen den Umgang einschränken.
-
In besonderen Fällen kann begleiteter Umgang (in Anwesenheit einer neutralen Fachkraft) angeordnet werden. In Ausnahmesituationen ist auch ein vorübergehender Umgangsausschluss möglich (§ 1684 Abs. 4 BGB).
Woran orientiert sich das Gericht?
-
Am Kindeswohl – das heißt: Was ist für das Kind am besten? Dies ist der oberste Maßstab jeder Entscheidung (§ 1697a BGB).
-
Berücksichtigt werden: die emotionale Bindung zu beiden Eltern, Stabilität und Kontinuität im Alltag, Förderung der Entwicklung und Schutz vor Konflikten.
-
Kinder werden gehört: Ab etwa 3–4 Jahren werden Kinder altersgerecht nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt (§ 159 Abs. 2 FamFG). Ihre Meinung wird berücksichtigt, ist aber nicht allein entscheidend – das Gericht prüft immer, was objektiv dem Kindeswohl dient.
Welche Rolle spielt das Jugendamt?
-
Das Jugendamt berät und vermittelt zwischen den Eltern – kostenfrei und vertraulich.
-
Es kann bei der Ausarbeitung praktischer Umgangsregelungen helfen.
-
In gerichtlichen Verfahren wird das Jugendamt regelmäßig beteiligt und gibt eine fachliche Stellungnahme ab (§ 162 FamFG).
Können Umgangsregelungen in einer Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten werden?
-
Ja, dies ist rechtlich möglich und sehr sinnvoll.
-
Die Vereinbarung kann notariell beurkundet oder beim Familiengericht protokolliert werden.
-
Sie schafft Rechtssicherheit für beide Seiten und kann bei Nichteinhaltung auch vollstreckt werden (§ 86 FamFG).
Was kann ich tun, wenn der Umgang nicht stattfindet?
-
Zunächst sollte das Gespräch gesucht oder das Jugendamt zur Vermittlung eingeschaltet werden.
-
Bei fortgesetzter Verweigerung kann das Familiengericht angerufen werden.
-
Das Gericht kann Zwangsgeld verhängen oder in letzter Konsequenz Ordnungshaft anordnen (§ 89 FamFG) – diese Mittel werden aber nur als letzter Ausweg eingesetzt.
Wie können wir Sie unterstützen?
Wir begleiten Sie auf drei Wegen – je nachdem, was Ihre Situation erfordert:
1. Außergerichtliche Beratung
-
Entwicklung individueller Umgangsregelungen, die zu Ihrer Familiensituation passen
-
Ausarbeitung von Scheidungsfolgenvereinbarungen
-
Unterstützung bei der Kommunikation mit dem Jugendamt
2. Familienrechtliche Mediation
-
Gemeinsame Lösungsfindung auf Augenhöhe
-
Auch in hochstrittigen Situationen
-
Erarbeitung nachhaltiger Vereinbarungen ohne Gerichtsverfahren
-
Mediation ermöglicht es, Interessen und Bedürfnisse beider Seiten offenzulegen und konstruktiv zu verhandeln.
3. Gerichtliche Vertretung
-
Durchsetzung Ihrer Rechte vor dem Familiengericht
-
Wenn eine einvernehmliche Lösung nicht (mehr) möglich ist
-
Professionelle Prozessführung mit dem Ziel, eine kindeswohlorientierte Entscheidung zu erreichen
Unser Ziel: Lösungen finden, die das Wohl Ihrer Kinder schützen und Ihre Interessen wahren – ob im Gespräch, in der Mediation oder vor Gericht.
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, um Vermögensverschiebungen während der Trennungszeit rückgängig zu machen oder abzusichern?
Die Situation
Wenn sich Ehepartner trennen, kommt es häufig vor, dass ein Partner größere Vermögenswerte verschiebt, verschenkt oder überträgt. Die Motive können unterschiedlich sein – manchmal aus Sorge um den eigenen Anteil beim späteren Zugewinnausgleich, manchmal mit der Absicht, den anderen Partner wirtschaftlich zu benachteiligen. Die finanziellen Folgen können in jedem Fall erheblich sein.
Ihre Rechte: Das Gesetz schützt Sie
Die gute Nachricht: Es gibt wirksame rechtliche Mittel, um sich gegen solche Vermögensverschiebungen zu wehren.
Grundsätzliche Pflichten während der Ehe
Das Gesetz verpflichtet beide Ehepartner, während der gesamten Ehezeit – auch nach der Trennung bis zur rechtskräftigen Scheidung – verantwortungsvoll mit dem Vermögen umzugehen. Ungewöhnliche Vermögensverfügungen auf Kosten des anderen Partners sind nicht erlaubt.
Was passiert bei Verstößen?
Wenn Ihr Partner trotz Trennung Vermögen verschenkt, verschleudert oder bewusst beiseite schafft, haben Sie einen wichtigen Anspruch: Sie können verlangen, beim Zugewinnausgleich so behandelt zu werden, als ob das Vermögen noch vorhanden wäre. Das verschwundene Vermögen wird also rechnerisch „zurückgeholt“.
Konkrete Rechtsmittel
1. Anfechtung von Vermögensübertragungen
In bestimmten Fällen können Sie Vermögensübertragungen direkt angreifen – besonders dann, wenn diese nur dazu dienten, Ihre Ansprüche zu verringern oder ganz zu umgehen.
2. Sofortige Sicherungsmaßnahmen
Bei begründetem Verdacht können Sie beim Gericht beantragen:
-
Einstweilige Verfügung: Verhindert weitere unrechtmäßige Vermögensverschiebungen
-
Arrest: Sichert konkrete Vermögenswerte kurzfristig
-
Kontensperrung oder Verfügungsverbot: Stoppt weitere Transaktionen
3. Beweissicherung – Ihr wichtigster Schritt
Handeln Sie schnell und dokumentieren Sie alles:
-
Kontoauszüge kopieren und sichern
-
Depotauszüge sammeln
-
Immobilienunterlagen sicherstellen
-
Alle Vermögensbewegungen protokollieren
Warum ist das so wichtig? Nur mit vollständiger Dokumentation können Sie später beweisen, ob und in welchem Umfang Vermögensverschiebungen stattgefunden haben.
Fazit
Die Durchsetzung Ihrer Ansprüche hängt stark von den konkreten Umständen Ihres Falls ab. Jede Situation ist einzigartig und erfordert eine maßgeschneiderte rechtliche Strategie.
Unser Tipp: Lassen Sie sich frühzeitig anwaltlich beraten. So können Sie die geeigneten Schritte rechtzeitig prüfen und umsetzen, bevor wichtige Fristen verstreichen oder Beweise verloren gehen.