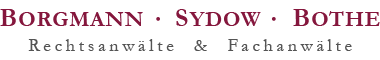Das Arbeitsrecht hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung und Komplexität gewonnen, womit wir als Anwalt für Arbeitsrecht aus Berlin regelmäßig befasst sind. Es umfasst eine Vielzahl einzelner Gesetze sowie tarifvertraglicher Regelungen und wird maßgeblich durch eine sich ständig weiterentwickelnde Rechtsprechung geprägt.
Für eine erfolgreiche arbeitsrechtliche Beratung und Prozessvertretung ist daher nicht nur die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen, sondern insbesondere auch die fortlaufende Auswertung aktueller Entscheidungen der Arbeitsgerichte entscheidend. Wir beraten und vertreten Sie engagiert und praxisnah – sowohl außergerichtlich als auch vor den Arbeitsgerichten.
Unsere Schwerpunkte im Arbeitsrecht als Anwalt für Arbeitsrecht in Berlin
Die fachlichen Schwerpunkte unserer Tätigkeit liegen im Individual- und Kollektivarbeitsrecht, im Disziplinarrecht sowie im Bereich der Zeitwertkonten. Wir unterstützen Sie unter anderem in folgenden Bereichen:
- Gestaltung und Prüfung sowie Änderung von Arbeitsverträgen
- Kündigung und Kündigungsschutzklage sowie Aufhebungsvertrag
- Abfindung und Abwicklungsvereinbarungen
- Abmahnung und Versetzung sowie Konflikte im laufenden Arbeitsverhältnis
- Befristung, Teilzeit und Elternzeit sowie sonstige Vertragsgestaltungen
- Zeugnisse (Zwischen- und Endzeugnis)
- Tarifrecht und Betriebsvereinbarungen sowie Mitbestimmung
Unsere Experten: Fachanwältin für Arbeitsrecht Anja Bothe und Rechtsanwalt Olav Sydow
 |
 |
Bei uns finden Sie mit Fachanwältin für Arbeitsrecht Anja Bothe und Rechtsanwalt Olav Sydow sachkundige, erfahrene und auf das Arbeitsrecht spezialisierte Ansprechpartner. Wir unterstützen Sie bei allen arbeitsrechtlichen Anliegen – sei es als Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder in anderer Weise.
Typische Anliegen – womit wir Ihnen als Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin helfen
Gegenstand unserer Beratungs- und Vertretungspraxis ist das gesamte Arbeitsrecht. Dies betrifft insbesondere:
- die Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses (Gestaltung/Prüfung von Arbeitsverträgen)
- Probleme im laufenden Arbeitsverhältnis (z. B. Abmahnung, Versetzung, Vergütung sowie Arbeitszeit)
- die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abfindung, Vergleich)
Kurze Fristen im Arbeitsrecht beachten
Als Arbeitnehmer ist insbesondere zu beachten, dass die Fristen für die Einreichung einer Klage gegen eine Kündigung sehr kurz sind und daher schnelles Handeln erforderlich ist. Eine Kündigungsschutzklage muss in der Regel gemäß § 4 KSchG spätestens drei Wochen nach Zugang der Kündigung erhoben werden. Wenn Sie sich gegen eine Kündigung wehren möchten, vereinbaren Sie bitte sofort einen Termin, damit diese Frist nicht versäumt wird.
Ablauf vor dem Arbeitsgericht
Vor dem Arbeitsgericht findet zunächst eine Güteverhandlung statt – häufig innerhalb weniger Wochen nach Klageeinreichung. Dabei wird versucht, eine gütliche Einigung zu erreichen, etwa durch Vereinbarung einer Abfindung oder einer sonstigen Vergleichslösung. Scheitert eine Einigung, wird das Verfahren in einem weiteren Termin streitig fortgeführt.
Kostenverteilung beim Streit vor dem Arbeitsgericht
Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Verfahren vor dem Arbeitsgericht in der ersten Instanz ihre Kosten (insbesondere Anwaltskosten) grundsätzlich selbst. Die Rechtsanwaltsgebühren ergeben sich aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und richten sich in Kündigungsschutzverfahren regelmäßig nach dem zuletzt erzielten Einkommen.
Beratungstermin vereinbaren
Vereinbaren Sie mit uns einen Besprechungstermin. Wir klären gerne mit Ihnen alle anstehenden Fragen ausführlich und in Ruhe – und zeigen Ihnen eine rechtlich und strategisch sinnvolle Vorgehensweise auf.
FAQ: Häufige Fragen und Antworten zum Arbeitsrecht:
Welche formalen und inhaltlichen Anforderungen muss eine Kündigung erfüllen, um im Streitfall vor dem Arbeitsgericht Bestand zu haben?
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses – Das müssen Sie wissen
Damit eine Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wirksam ist und vor dem Arbeitsgericht Bestand hat, müssen strenge formale und inhaltliche Anforderungen eingehalten werden. Das deutsche Arbeitsrecht stellt hohe Vorgaben an Arbeitgeber. Bereits scheinbar kleine Fehler können dazu führen, dass eine Kündigung unwirksam ist – mit der Folge, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht oder zumindest gute Chancen auf eine Abfindung bestehen.
1. Schriftform ist Pflicht
Eine Kündigung muss zwingend schriftlich erfolgen (§ 623 BGB). Elektronische Formen sind gesetzlich ausgeschlossen. Unzulässig sind insbesondere Kündigungen per:
-
E-Mail
-
Fax
-
SMS
-
WhatsApp oder andere Messenger
Fehlt die Schriftform, ist die Kündigung nichtig, also von Anfang an unwirksam.
Wichtig: Die Kündigung muss eigenhändig handschriftlich unterschrieben sein. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH oder AG) muss eine vertretungsberechtigte Person unterschreiben, wenn eine Gesamtvertretungsbefugnis (z. B. zwei Geschäftsführer) besteht, müssen alle erforderlichen Personen unterzeichnen.
2. Zugang der Kündigung
Eine Kündigung entfaltet ihre rechtliche Wirkung erst mit dem Zugang beim Arbeitnehmer. Zugang liegt vor, wenn das Kündigungsschreiben so in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangt, dass er es unter normalen Umständen zur Kenntnis nehmen kann.
Beispiele für einen wirksamen Zugang:
-
Persönliche Übergabe mit Unterschrift des Arbeitnehmers als Empfangsbestätigung
-
Zustellung per Einwurf-Einschreiben
-
Zustellung durch einen Boten, der den Einwurf bezeugen kann
Hinweis: Der Zeitpunkt des Zugangs ist entscheidend für
-
den Beginn der Kündigungsfrist und
-
die Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage (drei Wochen ab Zugang der Kündigung (§ 4 KSchG).
3. Inhaltliche Anforderungen an eine Kündigung
Die Kündigungserklärung muss klar und eindeutig formuliert sein. Es muss zweifelsfrei erkennbar sein, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden soll und zu welchem Zeitpunkt.
Unzureichend sind etwa Formulierungen wie:
„Wir beabsichtigen, das Arbeitsverhältnis zu beenden.“
4. Beteiligung des Betriebsrats
Wenn ein Betriebsrat besteht, muss dieser vor jeder Kündigung ordnungsgemäß angehört werden (§ 102 BetrVG). Unterbleibt die Anhörung oder ist sie fehlerhaft, so ist die Kündigung automatisch unwirksam.
Wichtig:Im Kündigungsschreiben selbst muss nicht erwähnt werden, wie sich der Betriebsrat geäußert hat. Entscheidend ist allein, dass die Anhörung tatsächlich erfolgt ist.
5. Kündigungsgründe
-
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber bei einer ordentlichen Kündigung keinen Kündigungsgrund im Schreiben angeben.
-
Ausnahmen gelten insbesondere:
-
bei Auszubildenden (§ 22 BEEG).
-
bei außerordentlichen (fristlosen) Kündigungen: hier muss der Grund auf Verlangen des Arbeitnehmers unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.
Unabhängig davon muss der Kündigungsgrund im Streitfall vor Gericht tragfähig sein.
6. Besondere Kündigungsschutzrechte
Für bestimmte Personengruppen besteht ein besonderer Kündigungsschutz, wo eine Kündigung nur mit vorheriger Zustimmung einer Behörde zulässig ist:
-
Schwangere und Mütter (§ 17 MuSchG)
-
Schwerbehinderte (§ 168 SGB IX)
-
Betriebsratsmitglieder (§ 15 KSchG)
-
Arbeitnehmer in Elternzeit (§ 18 BEEG)
Wichtig: Auch wenn eine erforderliche Zustimmung fehlt, muss der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Andernfalls gilt die Kündigung trotz des Fehlers als wirksam.
7. Fazit
Eine wirksame Kündigung des Arbeitsverhältnisses setzt die Einhaltung strenger formaler und rechtlicher Anforderungen voraus. Schriftform, ordnungsgemäßer Zugang, klare Formulierungen und Beteiligung des Betriebsrats sowie besondere Schutzrechte spielen dabei eine zentrale Rolle. Werden diese Anforderungen nicht eingehalten, ist die Kündigung häufig angreifbar oder unwirksam.
Eine frühzeitige arbeitsrechtliche Beratung hilft, Fristen einzuhalten und die eigenen Rechte konsequent durchzusetzen.
-
Wann ist der Abschluss eines Aufhebungsvertrags gegenüber einer Kündigung rechtlich und wirtschaftlich vorzuziehen – auch im Hinblick auf Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld?
Ein Aufhebungsvertrag kann in bestimmten Situationen die bessere Lösung sein – sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich, denn er eröffnet beiden Vertragsparteien Gestaltungsspielräume, die bei einer Kündigung regelmäßig nicht bestehen.
Gerade dann, wenn eine Kündigung bereits im Raum steht oder das Arbeitsverhältnis belastet ist, kann ein Aufhebungsvertrag eine sinnvolle Alternative darstellen.
Allerdings sind dabei zahlreiche rechtliche und wirtschaftliche Aspekte zu beachten, damit spätere Nachteile vermieden werden.
Was ist der Unterschied zwischen Kündigung und Aufhebungsvertrag?
-
Kündigung: Eine einseitige Erklärung des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers, die gesetzlichen Fristen sowie dem Kündigungsschutzrecht unterliegt.
-
Aufhebungsvertrag: Eine einvernehmliche Vereinbarung beider Parteien, durch die das Arbeitsverhältnis zu einem frei vereinbarten Zeitpunkt endet.
Welche Vorteile bietet ein Aufhebungsvertrag?
Mit einem Aufhebungsvertrag lassen sich die Bedingungen der Beendigung flexibler gestalten, denn viele Punkte können individuell geregelt werden:
-
Freie Festlegung des Beendigungsdatums
-
Vereinbarung einer Abfindung
-
Abstimmung über Inhalt und Form des Arbeitszeugnisses
-
Regelungen zu Resturlaub, Überstunden und Freistellung
Wirtschaftliche Vorteile
Für den Arbeitnehmer:
-
Mögliche Abfindungszahlung
-
Schnellere berufliche Neuorientierung, weil klare Verhältnisse geschaffen werden
-
Steuerlicher Vorteil: Auf Abfindungen fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an, sondern lediglich Lohn- bzw. Einkommensteuer.
Für den Arbeitgeber:
-
Planbare Beendigung ohne Kündigungsschutzverfahren
-
Vermeidung langwieriger und kostenintensiver Rechtsstreitigkeiten
⚠️ Wichtiger Hinweis: Sperrzeit beim Arbeitslosengeld
Die Regel:
Ein Aufhebungsvertrag führt gemäß § 159 SGB III regelmäßig zu einer Sperrzeit von bis zu zwölf Wochen beim Arbeitslosengeld, da das Arbeitsverhältnis freiwillig beendet wird.
Die Ausnahme:
Keine Sperrzeit tritt ein, wenn ein sogenannter „wichtiger Grund“ vorliegt.
Unser Rat
Lassen Sie sich vor Abschluss eines Aufhebungsvertrags anwaltlich beraten, denn nur so lassen sich rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten optimal nutzen und wirtschaftliche Nachteile vermeiden.
Wie wirken sich tarifvertragliche, betriebliche oder individualvertragliche Regelungen auf Abfindungsansprüche aus?
Abfindung im Arbeitsrecht
Abfindungen spielen im deutschen Arbeitsrecht eine wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit Kündigungen, Aufhebungsverträgen und betrieblichen Umstrukturierungen. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme gibt es jedoch keinen automatischen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Ob und in welcher Höhe Sie eine Abfindung erhalten, hängt vielmehr von den konkreten Regelungen ab, die auf Ihr Arbeitsverhältnis Anwendung finden, sowie von Ihrer individuellen Verhandlungssituation.
1. Tarifvertragliche Regelungen
Ist Ihr Arbeitgeber tarifgebunden und fällt Ihr Arbeitsverhältnis unter einen Tarifvertrag (häufig in Verbindung mit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft), können sich daraus konkrete Abfindungsansprüche ergeben. Tarifverträge enthalten bei betriebsbedingten Kündigungen oder Restrukturierungen oft feste Berechnungsmodelle.
-
Konkrete Beträge: Häufig wird eine Formel angewendet, etwa „0,5 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr“. Bei zehn Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Monatsgehalt von 3.000 € ergäbe dies beispielsweise eine Abfindung von 15.000 €.
-
Mindeststandard: Diese tariflichen Abfindungen stellen meist einen Mindestbetrag dar und können – abhängig von der Situation – durch individuelle Verhandlungen noch erhöht werden.
2. Betriebliche Regelungen (Sozialpläne)
Bei größeren Betriebsänderungen, Umstrukturierungen oder Massenentlassungen wird zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat häufig ein Sozialplan abgeschlossen. Dieser dient dazu, wirtschaftliche Nachteile für die betroffenen Arbeitnehmer abzumildern.
-
Für alle verbindlich: Ein Sozialplan gilt grundsätzlich für alle betroffenen Beschäftigten und ist rechtlich verbindlich.
-
Berechnungskriterien: Die Abfindungshöhe orientiert sich meist an Faktoren wie Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten sowie teilweise auch an der Höhe des Einkommens.
-
Achtung: Sozialpläne enthalten oft Ausschlusstatbestände, etwa bei Eigenkündigung, verhaltensbedingter Kündigung oder bei Arbeitnehmern, die kurz vor dem Renteneintritt stehen.
3. Individuelle Vereinbarungen
Unabhängig von Tarifverträgen oder Sozialplänen besteht häufig die Möglichkeit, dass Sie eine Abfindung individuell aushandeln. Dies geschieht besonders häufig im Rahmen eines Aufhebungsvertrags oder eines Kündigungsschutzverfahrens vor dem Arbeitsgericht.
-
Frei verhandelbar: Gibt es keine zwingenden Regelungen, sind Höhe und Zahlungszeitpunkt sowie weitere Bedingungen grundsätzlich Verhandlungssache.
-
Ohne Gewerkschaft möglich: Auch ohne Tarifbindung oder Betriebsrat können Arbeitnehmer erfolgreich eine Abfindung erzielen, insbesondere wenn die Kündigung rechtlich angreifbar ist.
Wichtig zu wissen
Ein direkter gesetzlicher Anspruch auf Abfindung besteht nur in einem Ausnahmefall: Wenn der Arbeitgeber bei einer betriebsbedingten Kündigung ausdrücklich eine Abfindung nach § 1a Kündigungsschutzgesetz anbietet, sofern der Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage verzichtet. Diese Konstellation ist in der Praxis jedoch eher selten.
Unser Rat
Vor einer Kündigung oder dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags sollten Sie sorgfältig prüfen:
-
Gilt für Ihr Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag?
-
Existiert ein Sozialplan in Ihrem Betrieb?
-
Welche Verhandlungsspielräume bestehen realistisch?
-
Wie sind Ihre Chancen in einer Kündigungsschutzklage?
Eine frühzeitige rechtliche Beratung hilft Ihnen, Ihre Position realistisch einzuschätzen und sicherzustellen, dass Sie keine finanziellen Ansprüche verschenken.
Welche Fristen gelten für die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis, insbesondere bei Ausschlussklauseln?
⚠️ Achtung Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen: Oft gelten sehr kurze Fristen!
Wer zu lange wartet, verliert seine Ansprüche – selbst wenn sie berechtigt sind. Hier erfahren Sie, welche Fristen Sie unbedingt beachten müssen.
Die wichtigsten Fristen auf einen Blick
Besonders dringend: 3 Wochen bei Kündigung
Wenn Sie eine Kündigung erhalten, haben Sie gemäß § 4 KSchG nur 3 Wochen Zeit, um dagegen beim Arbeitsgericht zu klagen. Diese Frist beginnt ab dem Tag, an dem Ihnen die Kündigung zugeht.
Wichtig: Diese Frist gilt immer – egal, was in Ihrem Arbeitsvertrag steht. Wer sie versäumt, kann die Kündigung nicht mehr anfechten, selbst wenn sie unrechtmäßig war.
Unser Tipp: Lassen Sie sich sofort nach Erhalt einer Kündigung beraten. Selbst wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob Sie klagen wollen – die Frist läuft bereits.
Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen (3–6 Monate)
Die meisten Arbeitsverträge, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen enthalten sogenannte Ausschlussklauseln (auch Verfallsfristen genannt). Diese verkürzen die normale gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren erheblich.
Was bedeutet das konkret? Ansprüche wie Lohn, Überstundenvergütung, Urlaubsabgeltung oder Weihnachtsgeld müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich bei Ihrem Arbeitgeber anmelden – oft innerhalb von:
- 3 Monaten oder
- 6 Monaten
nach Fälligkeit.
Beispiel: Ihr Arbeitgeber zahlt im Januar die Dezember-Überstunden nicht. Wenn Ihr Vertrag eine 3-Monats-Frist enthält, müssen Sie das Geld bis spätestens Ende März schriftlich fordern – sonst verfällt Ihr Anspruch endgültig.
Zweistufige Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen – doppelte Gefahr
- Erste Stufe: Sie müssen Ihren Anspruch innerhalb von z. B. 3 Monaten schriftlich beim Arbeitgeber geltend machen.
- Zweite Stufe: Wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, müssen Sie innerhalb weiterer 3 Monate Klage beim Arbeitsgericht einreichen.
Achtung: Beide Fristen müssen eingehalten werden!
Gesetzliche Verjährung: 3 Jahre
Wenn Ihr Arbeitsvertrag keine Ausschlussklausel enthält, gilt die normale gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren. Diese beginnt am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.
Beispiel: Unbezahlter Lohn aus März 2024 verjährt Ende 2027.
Wann sind Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen unwirksam?
Nicht jede Ausschlussklausel ist rechtlich zulässig. Unwirksam sind sie zum Beispiel, wenn:
- sie unklar oder versteckt im Kleingedruckten formuliert sind,
- die Frist kürzer als 3 Monate ist,
- sie Mindestlohnansprüche ausschließen (das ist gesetzlich verboten!),
- sie Arbeitnehmer unangemessen benachteiligen.
Im Zweifel: Lassen Sie die Klausel prüfen – eine unwirksame Ausschlussklausel bedeutet, dass die normale 3-Jahres-Frist gilt.
So schützen Sie Ihre Ansprüche
- ✅ Prüfen Sie Ihren Arbeitsvertrag sofort – welche Fristen gelten für Sie?
- ✅ Dokumentieren Sie alles: Überstunden, nicht gezahlte Beträge, Kommunikation mit dem Arbeitgeber
- ✅ Fordern Sie Ansprüche immer schriftlich (E-Mail reicht meist, besser: Einschreiben mit Rückschein)
- ✅ Notieren Sie sich Fristen – setzen Sie sich Erinnerungen im Kalender
- ✅ Bei Kündigung: sofort handeln – Sie haben nur 3 Wochen Zeit!
- ✅ Holen Sie sich rechtzeitig Rat – besser eine Woche zu früh als einen Tag zu spät
Auch Arbeitgeber müssen Fristen beachten
Übrigens: Auch wenn Ihr Arbeitgeber Ansprüche gegen Sie hat (z. B. Schadensersatz oder Rückzahlung von Fortbildungskosten), muss er die Ausschlussfristen einhalten. Prüfen Sie im Zweifel, ob seine Forderung noch rechtzeitig geltend gemacht wurde.
Fazit: Zeit ist Geld – im wörtlichen Sinne
Im Arbeitsrecht können versäumte Fristen teuer werden. Selbst eindeutig berechtigte Forderungen können Sie nicht mehr durchsetzen, wenn Sie zu spät handeln.
Unser dringender Rat: Prüfen Sie bei jedem Anspruch sofort:
- Welche Frist gilt für mich?
- Wann läuft sie ab?
- Habe ich meine Forderung schriftlich gestellt?
Wenn Sie unsicher sind oder eine Kündigung erhalten haben – zögern Sie nicht und lassen Sie sich beraten, bevor es zu spät ist.
Betriebsbedingte Kündigung erhalten? Das müssen Sie wissen!
Eine betriebsbedingte Kündigung kann jeden treffen, ganz unabhängig von der eigenen Arbeitsleistung. Doch nicht jede Kündigung ist rechtmäßig. Hier erfahren Sie, welche Regeln Ihr Arbeitgeber einhalten muss und wo Sie ansetzen können.
Was ist eine betriebsbedingte Kündigung?
Ihr Arbeitgeber kann Ihnen betriebsbedingt kündigen, wenn:
-
Ihr Arbeitsplatz wegfällt (z. B. durch Betriebsschließung, Outsourcing, Automatisierung)
-
Das Unternehmen Personal abbauen muss
-
Es keine andere Beschäftigungsmöglichkeit für Sie gibt
Wichtig: Ihr Arbeitgeber muss dringende betriebliche Gründe nachweisen können. Eine vage Begründung wie „wirtschaftliche Schwierigkeiten“ reicht nicht aus.
Die Sozialauswahl – hier lohnt sich oft ein Angriff!
Wenn mehrere Mitarbeiter für eine Kündigung in Frage kommen, muss Ihr Arbeitgeber eine Sozialauswahl durchführen. Dabei werden Sie mit vergleichbaren Kollegen verglichen.
Diese Kriterien muss der Arbeitgeber berücksichtigen:
-
Betriebszugehörigkeit – Wie lange arbeiten Sie schon im Unternehmen?
-
Lebensalter – Ältere Arbeitnehmer sind schwerer vermittelbar
-
Unterhaltspflichten – Haben Sie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige?
-
Schwerbehinderung – Besonderer Schutz für schwerbehinderte Menschen
Beispiel: Sie sind 52 Jahre alt und seit 15 Jahren im Betrieb und haben zwei Kinder. Ein 28-jähriger Kollege ohne Kinder und 5 Jahren Betriebszugehörigkeit macht die gleiche Arbeit. Kündigt der Arbeitgeber Ihnen statt ihm, so ist die Sozialauswahl falsch und die Kündigung ist unwirksam!
Achtung „Leistungsträger“: Ihr Arbeitgeber kann besonders wichtige Mitarbeiter von der Kündigung ausnehmen, aber nur unter strengen Voraussetzungen. Oft wird dieses „Leistungsträgerprivileg“ rechtswidrig angewendet.
Unser Tipp: Lassen Sie die Sozialauswahl unbedingt prüfen! Fehler sind hier häufig und führen zur Unwirksamkeit der Kündigung.
Betriebsrat nicht angehört? Betriebsbedingte Kündigung unwirksam!
Wenn es in Ihrem Betrieb einen Betriebsrat gibt, muss dieser vor jeder Kündigung ordnungsgemäß angehört werden.
Häufige Fehler:
-
Betriebsrat wurde gar nicht informiert
-
Informationen waren unvollständig (z. B. fehlende Angaben zur Sozialauswahl)
-
Anhörungsfrist wurde nicht eingehalten
Folge: Die Kündigung ist unwirksam – selbst wenn die betrieblichen Gründe stimmen!
Interessenausgleich und Sozialplan – was bedeutet das für Sie?
Bei größeren Umstrukturierungen (ab 60 Mitarbeitern oft schon bei 6+ Kündigungen) muss der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat verhandeln:
1. Interessenausgleich
Eine Vereinbarung darüber, ob und wie die Betriebsänderung durchgeführt wird. Für Sie wichtig: Steht Ihr Name in einer Namensliste im Interessenausgleich, ist die Sozialauswahl nur eingeschränkt überprüfbar. Das macht es schwerer, sich gegen die Kündigung zu wehren.
2. Sozialplan
Ein Sozialplan regelt, welche Abfindungen und Ausgleichsleistungen Sie erhalten.
Typische Leistungen:
-
Abfindung (oft 0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr)
-
Überbrückungsgeld
-
Unterstützung bei der Jobsuche (Outplacement)
-
Weiterbildungsangebote
Achtung Ausschlüsse: Viele Sozialpläne enthalten Klauseln, die bestimmte Mitarbeiter ausschließen:
-
Bei Eigenkündigung (deshalb nie vorschnell selbst kündigen!)
-
Bei Rentennähe (z. B. wenn Sie innerhalb von 2 Jahren in Rente gehen können)
-
Bei Ablehnung eines Aufhebungsvertrags
Wichtig: Ein Sozialplan gilt für alle Betroffenen, dass heißt Sie müssen ihn nicht individuell aushandeln. Prüfen Sie aber, ob Sie alle Leistungen erhalten, die Ihnen zustehen!
Ihre Rechte bei betriebsbedingter Kündigung – Checkliste
-
3-Wochen-Frist beachten! Kündigungsschutzklage muss innerhalb von 3 Wochen eingereicht werden
-
Kündigungsgründe prüfen: Sind die betrieblichen Gründe nachvollziehbar?
-
Sozialauswahl kontrollieren: Wurden alle vergleichbaren Kollegen korrekt einbezogen?
-
Betriebsratsanhörung: Wurde der Betriebsrat ordnungsgemäß informiert?
-
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten: Hat der Arbeitgeber geprüft, ob Sie woanders im Betrieb einsetzbar sind?
-
Sozialplan prüfen: Erhalten Sie alle Leistungen, die Ihnen zustehen?
-
Arbeitszeugnis anfordern: Lassen Sie sich ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen
Wann lohnt sich eine Kündigungsschutzklage?
-
Die Sozialauswahl gemäß § 1 Abs 3 KSchG fehlerhaft ist
-
Der Betriebsrat nicht oder falsch angehört wurde
-
Die betrieblichen Gründe nicht ausreichend dargelegt sind
-
Sie hätten weiterbeschäftigt werden können
Auch ohne Erfolg vor Gericht: Oft einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Prozess auf eine höhere Abfindung, um das Verfahren zu beenden.
Fazit: Wehren Sie sich – es lohnt sich oft!
Betriebsbedingte Kündigungen sind rechtlich komplex. Viele Arbeitgeber machen Fehler bei der Sozialauswahl oder Betriebsratsanhörung. Selbst wenn die Kündigung letztlich wirksam ist, so können Sie oft eine deutlich höhere Abfindung aushandeln.
Unser Rat:
-
⏰ Handeln Sie sofort – die 3-Wochen-Frist ist unerbittlich
-
📄 Sammeln Sie alle Unterlagen (Kündigung, Arbeitsvertrag, Sozialplan)
-
🤝 Sprechen Sie mit Kollegen – wurden andere verschont, die sozial weniger schutzbedürftig sind?
-
⚖️ Lassen Sie sich beraten – die erste Einschätzung gibt oft schon Klarheit
Eine betriebsbedingte Kündigung ist kein Grund zur Resignation. In vielen Fällen können wir Ihnen helfen, sei es durch Aufhebung der Kündigung oder durch eine deutlich bessere Abfindung.